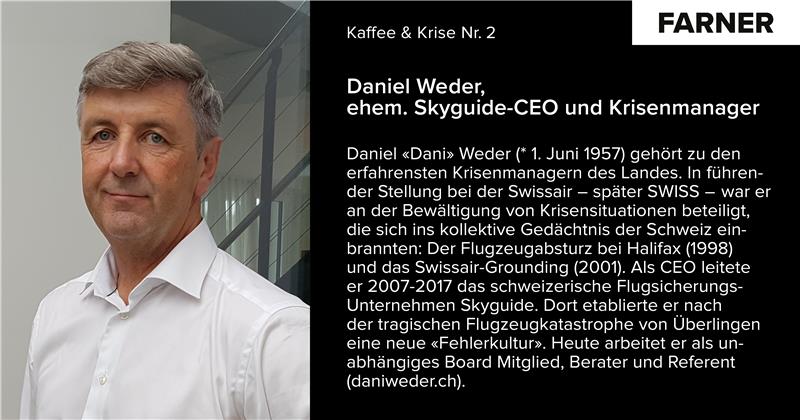
Herr Weder, wann ist erkennbar, dass man sich in einer Krise befindet?
Die Mechanismen einer Krise setzen meist ein, bevor sie als solche erkennbar sind – wir sprechen hier von sogenannten «weak signals». Das sind unscheinbare Vorkommnisse, welche einzeln genommen wenig wichtig sind, aber in der Summe eine Krise auslösen können. Krisenbewusstsein muss greifen, sobald sich eine Situation ausserhalb der Bandbreite der Normalität bewegt. Mein wichtigster Ratschlag für Verantwortliche: Es ist besser früher als später in den Krisenmodus zu wechseln und den «Notfallknopf» zu drücken. Das bedingt natürlich, gedanklich immer «auf Empfang» zu sein.
Das tönt anstrengend: Wie meinen Sie das?
Oft tendieren wir dazu, das Mögliche als unmöglich zu erachten… und dann passiert es doch. Eine Notfallorganisation muss auf den «schlimmstmöglichen» Fall ausgelegt sein – wir sprechen hier von «expect the unexpected». In jeder Organisation sollten folglich auch kleinere Zwischenfälle als Übungsgelegenheiten begriffen werden. Denn: Lange Handbücher helfen in Krisen wenig – entscheidend ist, dass Krisenmanagement im Alltag gelebt und trainiert wird. Das heisst: Auch kleinere Ereignisse mit den Krisenprozessen führen und Mitarbeitende aktiv ermutigen, frühzeitig Alarm auszulösen. Wenn sich dieser im Nachhinein als nichtig erweist, erhält man trotzdem wichtige Informationen zur Optimierung der Krisenorganisation. Und wichtig ist auch: Die Leute dürfen für einen Fehlalarm nicht kritisiert werden, es ist ihnen für ihre Professionalität zu danken.
Hunderte Tote, der Untergang der Swissair: Was war die grösste Herausforderung, die Sie in einer Krise meistern mussten – und welches Learning blieb Ihnen besonders?
Eines steht ganz klar immer im Vordergrund: der menschliche Aspekt. Bei Halifax* kannten wir einige der Opfer persönlich – das ging tief. Beim Swissair-Grounding verloren viele Mitarbeitende ihren Job. Und beim Crossair-Absturz bei Birchwil habe ich die Opfer selbst gesehen. In all diesen Fällen war psychologische Betreuung essenziell – für die Angehörigen, die Augenzeugen und für uns – was damals zum Teil noch improvisiert war, daraus entstanden die heutigen Care-Organisationen.
Welche Rolle spielten Sie nach dem Absturz von Swissair-Flug 111 bei Halifax (Kanada) als 265 Menschen starben?
Damals war ich Leiter der Einsatzleitstelle und Leiter der Krisenorganisation bei Swissair. Ein halbes Jahr vor Halifax erhielten wir den Auftrag, die Krisenorganisation neu aufzustellen. Drei Monate vor dem Absturz machten wir einen umfassenden Stresstest – das war im Nachhinein Glück im Unglück. So war einiges bereits eingespielt: Beispielsweise hatten wir die Prozesse neugestaltet, den Krisenraum direkt am Flughafen umgebaut sowie die Kommunikationsmittel neu eingerichtet
Halifax wird oft als Lehrbuchbeispiel guter Krisenkommunikation bezeichnet. Weshalb?
Ich denke, wir waren gut vorbereitet, der Krisenstab war schnell aktionsfähig mit sehr guten Stabchefs und einem sehr guten Team. Neben der Krisenkommunikation in Europa organisierten wir sehr schnell einen Flug nach Halifax … aber was viele bis heute nicht wissen: ein entscheidender Faktor war die kurz vorher eingegangene Partnerschaft mit Delta Airlines für Krisenfälle. Die nordamerikanische Fluggesellschaft war mit den lokalen Gegebenheiten vertraut, unterstützte uns mit ihrem Netzwerk und ihren Strukturen in Halifax. Innert kürzester Zeit stellten sie Kommandozentrale und Infrastrukturen, welche uns operativ vor Ort handlungsfähig machten. Es war aber auch ein wenig Glück im Spiel: Alle wichtigen Leute waren in der Nacht erreichbar und vor Ort.
Béatrice Tschanz wird in diesem Zusammenhang oft als Ikone der Krisenkommunikation genannt. Welche Rolle spielte sie?
Eine sehr wichtige – Béatrice Tschanz half durch ihre Erfahrung und Persönlichkeit, das Ganze kommunikativ zu führen, mit dem Resultat, dass wir immer einen Schritt voraus waren mittels regelmässiger Medienbriefings.
Was sagt man eigentlich auf einer Medienkonferenz, wenn man selbst kaum gesicherte Fakten kennt?
Der damalige Präsident der SAir-Group [Mutterkonzern, zu der die Swissair gehörte], Philipp Bruggisser, konnte an den ersten Medienkonferenzen wenig Inhaltliches sagen, da die Ursachen des Absturzes nicht klar waren. Dafür fokussierte er sich ausschliesslich auf die Fakten, zeigte seine Betroffenheit, sprach sein Mitgefühl aus, sagte aber auch offen: «Wir wissen noch nicht, was passiert ist – aber wir müssen vom Schlimmsten ausgehen.» Trotz mangelhafter Informationslage konnten wir durch die regelmässigen Medienbriefings die Kommunikationshoheit behalten und vermitteln, dass die Airline der äusserst schwierigen Situation gewachsen ist. In der heutigen Medienwelt wäre das aber wohl so nicht mehr möglich – Informationen aber auch Gerüchte und Fake News zirkulieren heute in Echtzeit.
An was würden Sie den Unterschied zur heutigen Zeit festmachen?
Heute kann es sein, dass die Aussenwelt mehr weiss als der Krisenstab. Alle haben heute eine Kamera bei sich, können von überall her kommunizieren. Desto wichtiger ist ein systematisches Social-Media-Monitoring. Trotzdem: Der Anspruch einer Organisation in der Krise bleibt, die Kommunikationsführerschaft zu erhalten und behalten – mit schnellen, gut getakteten Informations-Updates.
Die Krisenkommunikation der Schweizerischen Flugsicherung Skyguide nach dem tragischen Unfall von Überlingen missriet – was lief schief?
Leider lief einiges nicht optimal. Zwar gab es Handbücher für den Umgang mit Krisensituationen – aber sie waren theoretisch abgefasst und halfen nur bedingt. Pech war, dass Führungsexponenten nicht vor Ort waren bzw. im Ausland waren. Unter medialem Druck kam es zu verfrühten Statements, die sich im Nachhinein als unpräzise oder falsch erwiesen. Ein klassischer Fehler aus kommunikativer Sicht, wenn die Sachlage nicht geklärt ist.
Wie gingen Sie damit um, als Sie 2007 zu Skyguide kamen?
Als ich CEO von Skyguide wurde, wollte ich dazu beitragen, ein neues Mindset hinsichtlich Krisenprävention und Krisenbewältigung zu etablieren. Nach Amtsantritt bin ich zum Unfallort nach Überlingen gefahren. Ich wollte spüren und verstehen, was vor Ort passiert war. Wir haben in der Folge viele Prozesse überarbeitet, das Safety Management neu aufgestellt und eine sogenannte offene Fehlerkultur etabliert. Das Ziel ist, dass Mitarbeitende Fehler melden, ohne belangt zu werden. Es tönt ein wenig paradox: Eine steigende Anzahl von Fehlermeldungen ist an sich ein Zeichen für eine funktionierende Fehlerkultur, wobei es natürlich auf den Inhalt der Meldungen ankommt. Um der Sicherheit Nachdruck zu verleihen, stand bei jeder Geschäftsleitungssitzung «Safety» als Traktandum auf der Agenda.
Würden Sie heute etwas anders machen?
Rückblickend hätten wir bei der Krisenorganisation früher in die Skalierbarkeit der Unterstützung investieren sollen – externe Berater bereithalten, die im Ernstfall operativ unterstützen, neutral analysieren, rasch integrierbar sind. Zum Beispiel für die Kommunikation – in der heutigen Zeit von Social Media ist dies aus meiner Sicht unabdingbar.
Gibt es aus Ihrer Erfahrung weitere Grundprinzipien, an die sich Verantwortliche halten sollen?
Ja. Die ersten Minuten bis Stunden sind entscheidend, deshalb ist der schnelle Aufbau der Krisenorganisation elementar. Eine digital unterstützte Alarmauslösung muss oft geübt werden. Organisieren Sie Krisenprozesse ausschliesslich in vertrauter Umgebung und in der bestehenden Infrastruktur. Ein Krisenraum soll täglich genutzt werden, sonst funktionieren die Abläufe im Ernstfall kaum. Und: Üben, üben, üben – idealerweise zweimal jährlich mit echten Stresstests. Und: Ziehen Sie frühzeitig psychologische Hilfe bei, intern wie extern. In besonders harten Fällen ist es ratsam, Betroffene an einen anderen Ort zu verlegen, um sie vor der Öffentlichkeit und allfälliger Selbstjustiz zu schützen.
Was sind die häufigsten Fehler in der Krisenkommunikation?
Zu viel Papier, zu wenig Praxis. Dicke Handbücher helfen nicht – kurze, klare Checklisten schon. Auch fehlende Einsicht ist ein Problem. Nehmen Sie Jacqueline Fehrs jüngster Auftritt im Zürcher Kantonsrat und ihre emotional gehaltene Kritik an der GPK (Tages-Anzeiger). Dieser Eklat wird ihr politisches Erbe belasten, sollte sie sich nicht doch noch lernbereit zeigen. Fehlende Lernbereitschaft schadet aber nicht nur den Verantwortlichen selbst, sondern auch den betroffenen Organisationen.
Ein positives Beispiel?
Die Zürcher Kantonalbank: Als ein technischer Fehler zu doppelten Lohnzahlungen führte (NZZ), übernahm das Unternehmen rasch die Verantwortung, erklärte sachlich – und die Situation beruhigte sich rasch.
Wie lebt es sich in einem Umfeld, in dem jeder Fehler potenziell katastrophal, gar tödlich sein kann?
Natürlich ist man bei so einem Job ständig etwas angespannt – auch wenn man ruhig schläft, bleibt eine gewisse Grundnervosität. Besonders bei Skyguide merkte ich: Solche Funktionen sollte man nicht viel länger als zehn Jahre ausüben. Das ist ungesund.
Die Psychologie spielt eine wichtige Rolle bei der Krisenbewältigung?
Eine grosse. Als Krisenmanager lebt man unter Dauerstress. Mein persönliches Heilmittel, um einen Ausgleich zu finden, war ein Maultier…
Ein Maultier?
Ja, ich kaufte ein Maultier. Das ruhige Gemüt und die Aufgabe, das Tier zu versorgen, lindern das Gefühl der Belastung und lenken einen ab – das tut gut.
Was halten Sie von Kommunikationsberatern?
Ein schlechter Berater verkauft Hochglanzfolien. Ein guter versteht dich, denkt strategisch, kann aber auch hands-on operativ unterstützen – begleitet dich wirklich.
Wie geht man mit Uneinigkeit im Krisenstab um?
Im regulären Unternehmensalltag ist Führung partizipativ. In der Krise müssen Entscheide aber top-down erfolgen. Auch dieser Umschaltmechanismus muss geübt werden. Zwar soll sich im Krisenstab jede und jeder einbringen – aber der führende Krisen-Chef oder die Krisen-Chefin müssen in schnellem Rhythmus entscheiden und das ist meistens nicht der CEO. Eine Krisenorganisation hat vielfach 24-Stundenbetrieb.
Sie haben den legendären Ansagetext beim Swissair-Grounding verfasst. Erinnern Sie sich?
Ja, ich erinnere mich sehr gut und ich kann ihn teilweise immer noch zitieren. „Meine Damen und Herren, liebe Fluggäste, aus finanziellen Gründen ist die Swissair nicht mehr in der Lage, ihre Flüge durchzuführen. Deshalb ist es uns nicht möglich, irgendwelche Kompensationen auszuzahlen, welche direkt durch diese Situation entstanden sind …». Wir haben mal einen Vorschlag gemacht und dann gab es Einiges hin und her um den Wortlaut bis zur endgültigen Fassung.
Gibt es besondere Geschehnisse, die sich Ihnen besonders ins Gedächtnis eingebrannt haben?
Ich erinnere mich an die zwei Millionen Franken Bargeld aufgeteilt in einzelne Couverts, mit denen wir Piloten losschickten, damit sie ihre Flugzeuge nach dem Grounding im Ausland wieder auftanken und zurückfliegen konnten. Aber solche und ähnliche Geschichten wären ein Thema für ein anderes Gespräch…
Vielen Dank für das Gespräch.
Das Interview mit Dani Weder wurde von Danial Naghizadeh und Martin Hofer geführt.
* Halifax: Am 2. September 1998 ereignete sich vor der Küste von Nova Scotia (Kanada), 30 Km vor dem Flughafen Halifax, das schwerste Unglück in der Geschichte der Schweizer Luftfahrt: Swissair-Flug 111, eine McDonnell Douglas MD-11, stürzte mit 229 Menschen an Bord ins Meer. Alle Insassen, darunter 49 Schweizer*innen, kamen ums Leben.
** Überlingen: Am 1. Juli 2002 kollidierten über Überlingen am Bodensee eine russische Tupolew Tu-154 der Bashkirian Airlines und eine Frachtmaschine vom Typ Boeing 757 der DHL in 11.000 Metern Höhe. Grund war eine unklare Kommunikation zwischen den Piloten und der schweizerischen Flugsicherung Skyguide, bei der widersprüchliche Anweisungen zur Flughöhe gegeben wurden. Bei dem Unglück starben 71 Menschen, darunter viele Kinder – es war eine der schwersten Flugzeugkatastrophen über deutschem Gebiet.